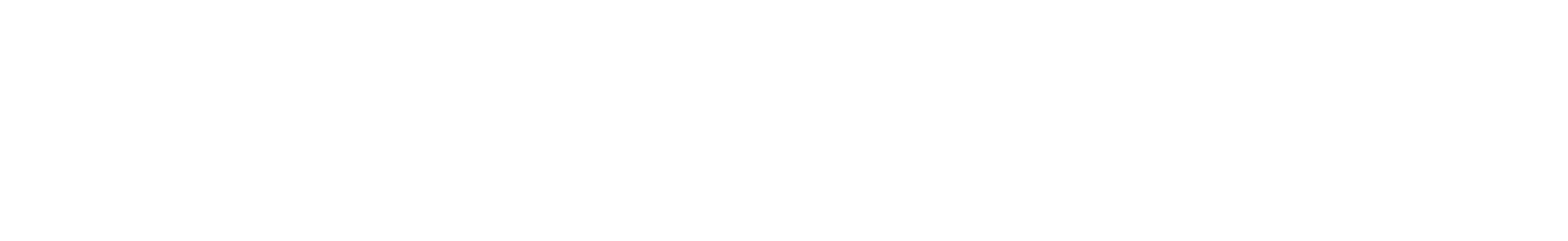„Pflanzenschützer des Jahres 2023“ gesucht!
Pflanzenschutz ist ein erklärungsbedürftiges Thema. Aus diesem Grund gibt es „Die Pflanzenschützer“ und die dazugehörige Mitmachaktion „Schau ins Feld!“. Jedes Jahr werden einige der teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte, die sich während der Saison in besonderem Maße engagiert haben, für ihren Einsatz ausgezeichnet.
Jetzt bewerben und Tickets für die IGW 2024 gewinnen
Die gesamte „Pflanzenschützer“-Community ist herzlich eingeladen, sich über das unten verlinkte Formular als „Pflanzenschützer des Jahres“ zu bewerben. Wir wählen zwei engagierte Teilnehmende aus und laden sie zu einem Besuch auf die Internationale Grüne Woche 2024 nach Berlin ein (inkl. Messeticket, Kostenübernahme für die An- und Abreise sowie Unterkunft).
Auf den Acker geschaut
Inzwischen gehören mehr als 1.000 Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Deutschland dem „Pflanzenschützer“-Netzwerk an. Sie legen ein oder mehrere „Schau!-Fenster“ am Feldrand, an der Obstwiese oder dem Weinberg an und stellen Infotafeln zu Biodiversität oder Zwischenfrüchten auf, um in den Dialog mit der Presse sowie mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu treten. So schaffen sie Aufmerksamkeit für Themen rund um den integrierten Pflanzenbau: für die verschiedenen Bausteine des Pflanzenschutzes, die sachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmaßnahmen, aber auch für andere relevante Themen wie Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Digitalisierung oder Biodiversität.
Die Teilnehmenden machen sichtbar, was sie im Laufe der Saison auf dem Acker machen, um ihre Pflanzen zu schützen und eine ausreichende Ernte zu sichern. Um die Reichweite für „Schau ins Feld!“ zu erhöhen, senden sie uns regelmäßig Fotos oder Videos und greifen die Aktion auch auf ihren eigenen Kanälen auf. Viele Teilnehmende nutzen Hoffeste oder anderen Veranstaltungen vor Ort, um mit Interessierten in den Austausch zu kommen. Hier unterstützen die Aktionsmaterialien der „Pflanzenschützer“ oder die Info-Broschüre Pflanzenschutz beim Einstieg in komplexe Themen.