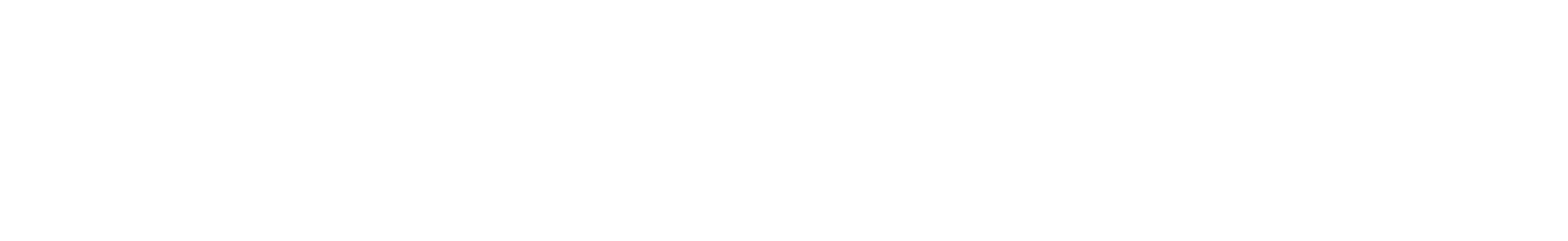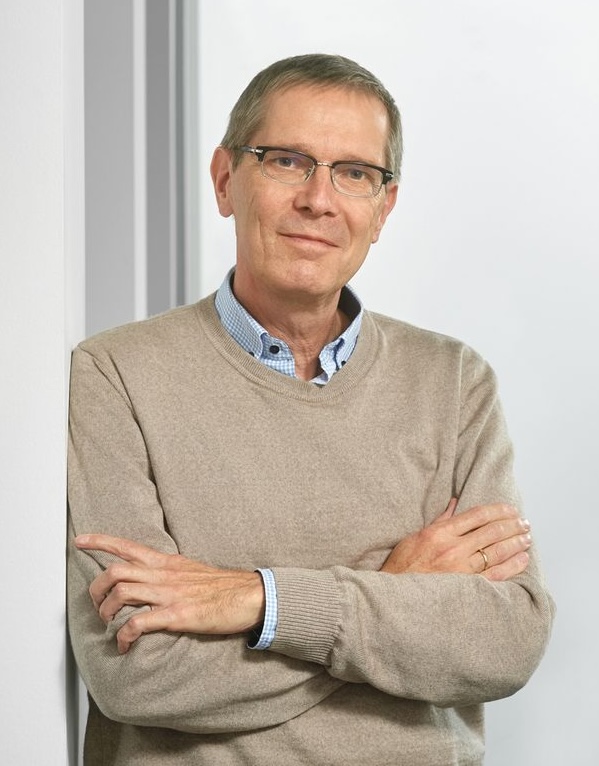Pflanzenschutz in der Krise: Weniger Mittel, mehr Resistenzen
In Deutschland stehen landwirtschaftliche Betriebe vor einer wachsenden Herausforderung: Es sind immer weniger Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel zugelassen. Das kann zu einem ernsten Problem für die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln werden. Besonders deutlich wird das bei einem immer schwerer kontrollierbaren Unkraut: dem Ackerfuchsschwanz.
Johannes Scharl ist Landwirt aus Eichstätt in Bayern. Er bewirtschaftet einen gemischten Betrieb mit 350 Zuchtsauen und rund 90 Hektar Ackerbau. Der Anbau von Futtermitteln wie Gerste, Triticale und Mais steht bei ihm im Mittelpunkt, ergänzt durch weitere Kulturen wie Raps und Weizen. Doch ihn treibt eine große Sorge um: Wie kann er künftig noch nachhaltig und umweltschonend Pflanzen anbauen, wenn der Werkzeugkasten mit Schutzinstrumenten immer kleiner wird?
Scharl erklärt: „Landwirte haben immer weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. Früher konnten wir aus einem breiten Spektrum an Produkten auswählen, Resistenzen gut im Griff haben und nachhaltig Ackerbau betreiben. Heute müssen wir uns auf einen immer kleineren Pool an Substanzen beschränken.“
Unkraut außer Kontrolle
Große Probleme sieht Scharl vor allem beim Ackerfuchsschwanz. Dieser wächst in Konkurrenz zu Wintergetreide und senkt die Erträge. Ohne Bekämpfung durch Herbizide verbreitet er sich schnell. In vielen Regionen, etwa in Norddeutschland, kann dieses Ungras nicht mehr effektiv bekämpft werden. „Die wichtigen Wirkstoffe wirken nicht mehr, weil der Ackerfuchsschwanz resistent geworden ist“, stellt Scharl fest. Erhebliche Ertragsausfälle sind die Folge.
Was tun gegen Ackerfuchsschwanz-Resistenzen?
Gegen Ackerfuchsschwanz setzt Scharl als ersten Schritt auf aktives Resistenzmanagement – er wechselt jedes Jahr die eingesetzten Herbizide, um Resistenzen gegen einen bestimmten Wirkstoff zu vermeiden. Durch die immer geringere Verfügbarkeit von verschiedenen Wirkprinzipien wird diese Strategie allerdings irgendwann an ein Ende kommen.
Deswegen dehnt Scharl als zweite Maßnahme die Fruchtfolge aus. Der Anbau von wechselnden Kulturen erschwert dem Ackerfuchsschwanz das Überleben.
Außerdem achtet Scharl darauf, dass er Wirkstoffe, die für Pflanzenschutzresistenz anfällig sind, nur sehr gezielt einsetzt. Er erklärt: „Ich verwende entsprechende Pflanzenschutzmittel nur, wenn ich in der Gerste Ackerfuchsschwanz habe. Bei Weizen gibt es Alternativen, die ich bevorzuge.“
Weitere Sorge: Ökologie
Eine weitere Sorge treibt Scharl im Zusammenhang mit Pflanzenschutzresistenzen um: Die abnehmende Vielfalt bei Herbiziden erschwert zunehmend die Einhaltung der Grundlagen des nachhaltigen Pflanzenschutzes. Der schrumpfende Werkzeugkasten führt langfristig zu einem höheren Einsatz von Spritzmitteln insgesamt, weil zukünftig mehrere Behandlungen nötig sein werden, um gute Erträge zu erzielen. „Ökologisch ist das nicht sinnvoll“, so Scharl. Lieber will er nur einmal ein effizientes Mittel einsetzen.
Für den Landwirt aus Bayern ist klar: Pflanzenschutz so wenig und so effektiv wie nötig einzusetzen funktioniert nur, wenn ausreichend Wirkstoffe zugelassen und auf dem Markt verfügbar sind.