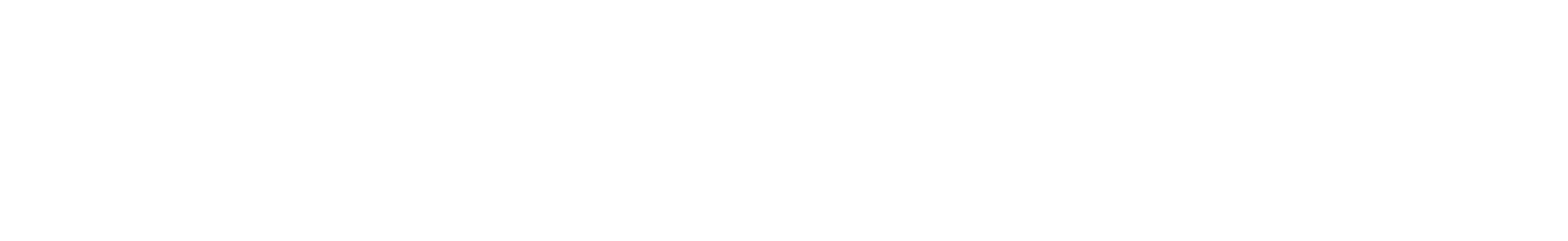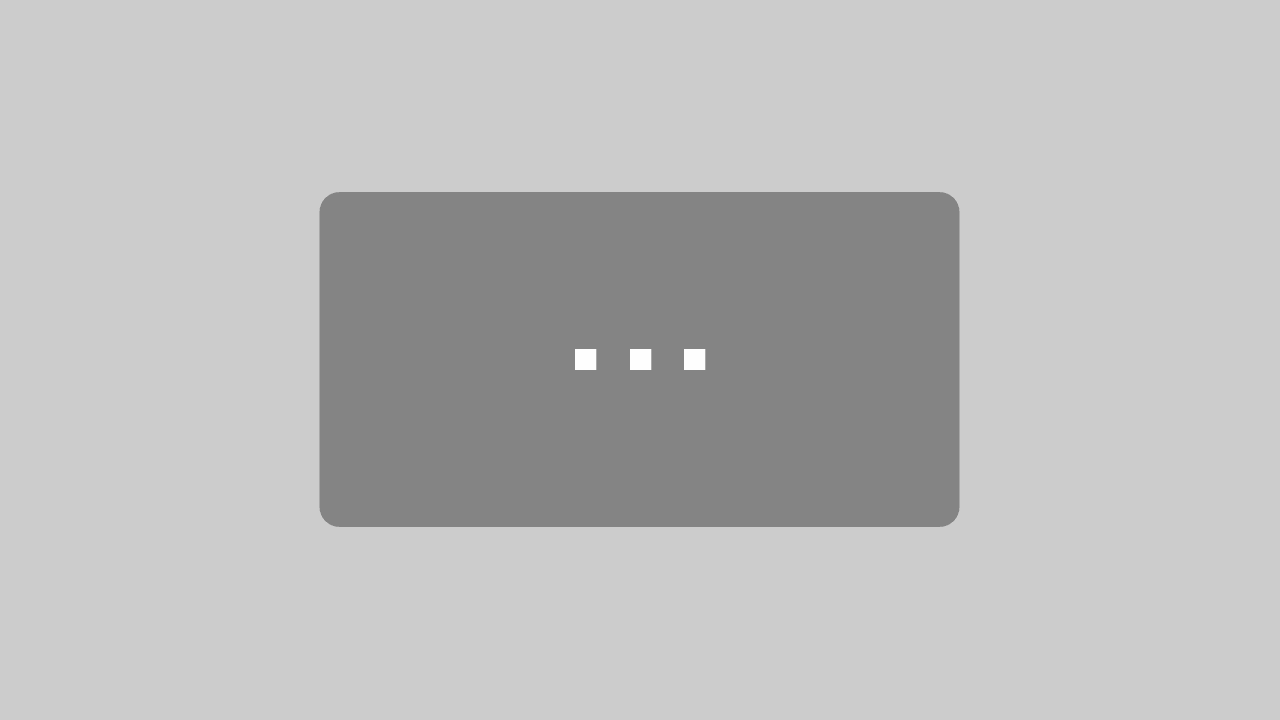Sind die Felder abgeerntet, werden sie nicht einfach sich selbst überlassen. Das Stichwort lautet „Feldhygiene“. Mit den richtigen Maßnahmen können Landwirtinnen und Landwirte schon jetzt einen wichtigen Grundstein legen, um ihren Bestand im kommenden Jahr vor Schädlingen und Unkräutern zu schützen. Dabei kommen vor allem Maßnahmen des acker- und pflanzenbaulichen sowie des mechanischen Pflanzenschutzes zum Einsatz.
Überbleibsel der Vorfrucht
Mit der Ernte soll die zuletzt angebaute Kultur vollständig vom Acker weichen. Die gerade abgeerntete Pflanze bezeichnet man nun als Vorfrucht. Zwar sind moderne Mähdrescher dazu in der Lage, die Ernte so zu dreschen, dass dabei möglichst wenig Erntegut verloren geht. Dennoch landen immer wieder einzelne Körner auf dem Acker. Das geschieht vor allem bei Kulturen mit besonders kleinen Körnern, wie dem Raps. Die auf dem Acker verbleibenden Samen der Vorfrucht würden kurze Zeit nach der Ernte wieder aufkeimen und sich mit der folgenden Frucht vermischen. Das hätte zwei Effekte: Erstens könnte die Vorfrucht dominanter als die Folgekultur sein und die Pflanzenarten würden um Nährstoffe, Wasser und Licht konkurrieren. Zweitens könnte die auf dem Acker verbleibende Vorfrucht die positiven Effekte der Fruchtfolge verringern: Der Landwirt wechselt unterschiedliche Pflanzenarten miteinander ab. Die Fruchtfolge soll vermeiden, dass sich Schädlinge und Krankheiten, die sich auf eine Kultur spezialisiert haben, im Feld halten und weiter vermehren. So lässt sich der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren.
Stoppelbearbeitung zum Erosionsschutz
Der erste Schritt nach der Ernte ist die sogenannte Stoppelbearbeitung. Dabei werden die auf dem Acker zurückgebliebenen Stängel und Stoppeln bearbeitet. Die dafür benutzten Geräte ritzen, schneiden und ratschen so über den Boden, dass alle Stängel und die Samen abgebrochen und leicht in den Boden eingearbeitet werden. Die Stängel müssen abgebrochen werden, da sie wie Trink-Strohhalme im Boden stecken und über Kapillarkräfte das Wasser aus dem Boden saugen. Ohne Bearbeitung könnten sie so die Verdunstung begünstigen und den Boden stark austrocknen. Auch die auf dem Feld verbliebenen Samen der Vorfrucht werden bei diesem Schritt eingearbeitet, um optimale Bedingungen für ein Aufkeimen zu schaffen. Ziel ist es nämlich, die Körner vollständig zum Aufkeimen zu bringen, um die unerwünschten Keimlinge dann in einem nächsten Schritt zu beseitigen.
Beseitigung von unerwünschten Pflanzen
Die Keimlinge der Vorfrucht und die Unkräuter, die nun ihre kurzzeitige Chance zum Wachsen hatten, müssen entsprechend beseitigt werden. Dafür gibt es die Möglichkeit des chemischen Pflanzenschutzes und die der mechanischen Bodenbearbeitung. Beide haben entsprechende Vorteile.
Die mechanische Bodenbearbeitung ist vor allem in der ökologischen Landwirtschaft das Mittel der Wahl. Um die Unkräuter und die Überbleibsel der Vorfrucht zu beseitigen, werden die Keimlinge zum Beispiel mitsamt dem Boden mit dem Pflug gedreht und begraben. Der Keimling ist zu schwach und schafft es nicht, sich einmal um 180° zu drehen und mehrere Zentimeter Boden zu durchwachsen. Mittlerweile wird oft vermieden, den Boden zu pflügen: Durch das Wenden des Bodens wird das empfindliche Bodengefüge gestört und der Boden außerdem Wind und Wetter preisgegeben. Bei der verbleibenden mechanischen Alternative werden die jungen Pflanzen abgetötet, durch mehrmaliges Schlitzen und Schneiden der obersten Bodenschicht. Das erfordert aber mehrere Überfahrten, ist daher arbeitsintensiv und verdichtet durch das Gewicht des Traktors den Boden.
Chemischer Pflanzenschutz hat den Vorteil, dass der Boden nicht gewendet werden muss. Dadurch bleibt das Bodengefüge erhalten und die toten Pflanzen bilden eine Humusauflage auf dem Boden. Außerdem ist der Dieselverbrauch beim Einsatz einer Feldspritze geringer als der eines Traktors mit Pflug, da in der Regel weniger Fahrten notwendig sind. Außerdem kann die Spritze breitere Streifen behandeln und muss nicht gegen den Boden arbeiten.
Die Feldhygiene nach der Ente ist ein zentraler Schritt für Landwirtinnen und Landwirte jeder Produktionsrichtung. Am Ende kann die Entscheidung für die korrekte Maßnahme aber oft nicht einfach nach Lehrbuch getroffen werden. Denn viele verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Vorfrucht, Probleme mit verschiedenen Unkräutern oder etwa die Witterungsbedingungen, beeinflussen die Auswahl passender Bausteine und Maßnahmen im integrierten Pflanzenbau.