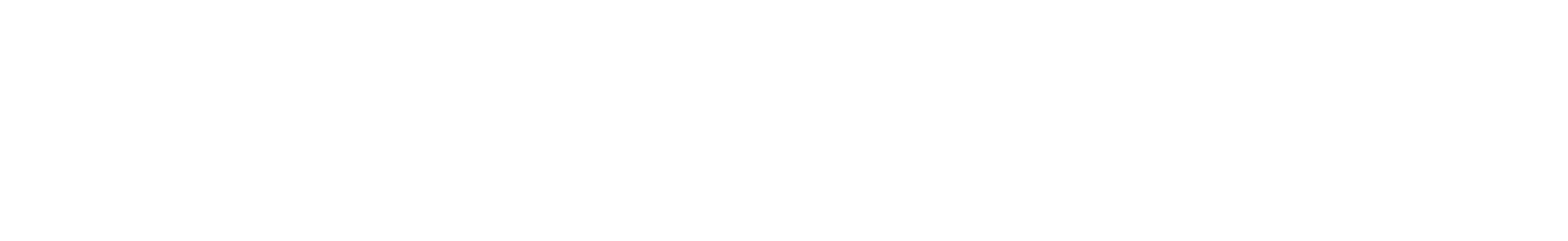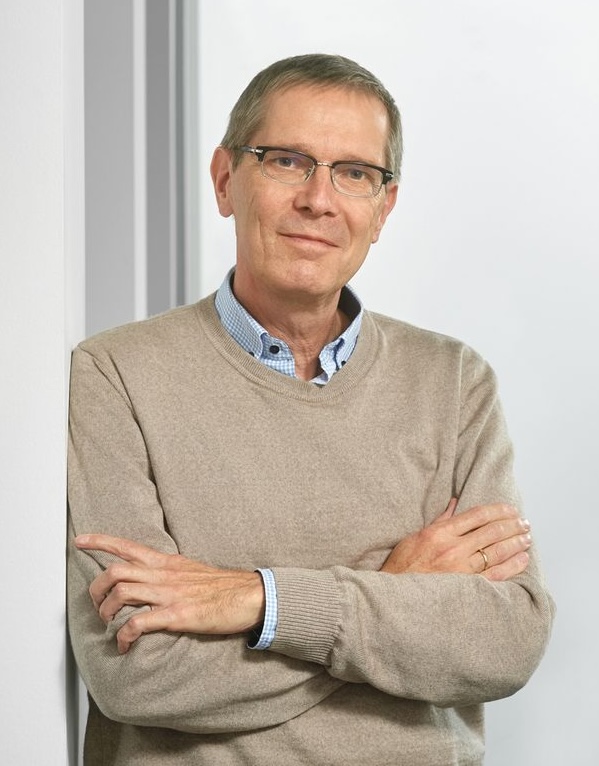Neue Gefahr für den Ackerbau: Weidelgras breitet sich aus
Was bislang vor allem mit Futterbau und Grünland assoziiert wurde, wird zunehmend zum Problem für den Ackerbau: Weidelgras. Bis zu 50 Prozent Ertragsverlust und immer weniger effektive Pflanzenschutzmittel, die dagegen helfen – dieses Problem betrifft mehr und mehr Agrarbetriebe in Deutschland. Dr. Dirk Wolber, Leiter des Sachgebiets Herbologie bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, beschreibt im Interview die Herausforderungen und erklärt, was Landwirtinnen und Landwirte dagegen tun können.
Herr Dr. Wolber, das Weidelgras breitet sich zunehmend auf Ackerflächen aus. Handelt es sich dabei um ein regionales Problem oder ist das inzwischen ein deutschlandweites Phänomen?
Dr. Wolber: Was zunächst regional begrenzt schien – etwa in Hessen und Sachsen, wo Weidelgras lange wächst – hat sich in den letzten Jahren rasant ausgeweitet. Besonders im norddeutschen Raum ist das Vorkommen mittlerweile sehr präsent. Inzwischen beobachten wir das Auftreten sogar auf Flächen, wo es weder vermehrt noch gezielt eingesät wurde. Das ist eindeutig kein regionales Thema mehr.

Dr. Dirk Wolber, Leiter Sachgebiet Herbologie, Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Welche Auswirkungen hat Weidelgras auf den Ackerbau?
Dr. Wolber: Die Ertragsverluste durch Weidelgras sind erheblich. Während beim Ackerfuchsschwanz mit bis zu 30 Prozent gerechnet werden muss, kann Weidelgras Einbußen von bis zu 50 Prozent verursachen. Das liegt an seiner Wuchsform, der Schnelligkeit, mit der es Flächen besetzt, und seiner starken Konkurrenz um Nährstoffe und Licht.
Hinzu kommt, dass Herbizide immer weniger wirken. Warum ist das so?
Dr. Wolber: Das liegt an der Resistenzentwicklung. Beim Ackerfuchsschwanz hat es zehn bis fünfzehn Jahre gedauert, bis Resistenzen auftraten. Beim Weidelgras reicht oft schon ein Zeitraum von drei bis vier Jahren. Je mehr Pflanzen auf der Fläche stehen, desto wahrscheinlicher ist, dass sich einzelne, resistente Individuen durchsetzen. Außerdem stehen uns immer weniger Wirkstoffe zur Verfügung – neue Wirkstoffgruppen fehlen seit 20 Jahren, und bestehende Mittel könnten bald wegfallen. Zum Beispiel soll Flufenacet bis Jahresende verboten werden.
Was empfehlen Sie den Landwirtinnen und Landwirten konkret, um Probleme mit Weidelgras in den Griff zu bekommen?
Dr. Wolber: Erster Schritt ist es, Flächen regelmäßig zu kontrollieren. Vor allem im Mai sind Weidelgrasnester gut erkennbar. Kleine Nester sollten manuell entfernt, größere gemulcht werden. Zweitens: Bei Saatgutmischungen genau hinsehen – kein Weidelgras mehr in Untersaaten oder Begrünungen verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass resistente Populationen in den Bestand eingetragen werden. Drittens: Lohnunternehmer zur Maschinenreinigung verpflichten – das ist ein zentraler Übertragungsweg.
Und was müsste politisch passieren?
Dr. Wolber: Die Politik sollte der Landwirtschaft wieder mehr Handlungsspielraum verschaffen – zum Beispiel durch praxisnahe und zügige Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel sowie gezielte Förderung der Forschung an neuen Wirkstoffen. Wenn der politische Kurs weiterhin auf eine pauschale Reduktion von Pflanzenschutzmitteln setzt, ohne tragfähige Alternativen zu schaffen, wird sich das Problem auf den Feldern weiter verschärfen. Auch die landwirtschaftliche Forschung braucht mehr Unterstützung: Klassische Ackerbauthemen finden in heutigen Drittmittelprojekten kaum noch Berücksichtigung.