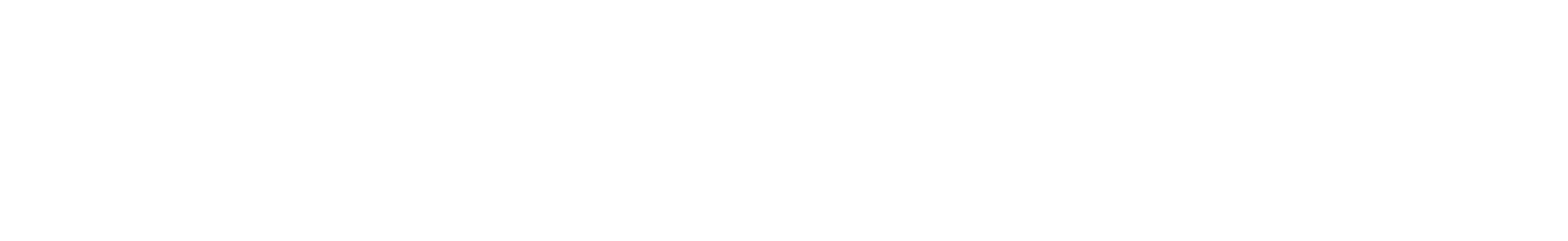Was ist dran am Vorwurf Monokultur?
„Mich stören ja die vielen Monokulturen, die man heutzutage überall sieht“. Solche Sätze hören Landwirtinnen und Landwirte nicht selten. Allerdings wird Monokultur oft mit Reinkultur verwechselt. Und eine Monokultur gilt es im Sinne der „guten fachlichen Praxis“ sowie einer wohl überlegten und standortangepassten Fruchtfolgeplanung ohnehin zu vermeiden.
Was ist eigentlich mit dem Begriff Monokultur gemeint?
Mit Monokultur meinen Verbraucherinnen und Verbraucher oft besonders große Felder auf denen nur eine einzige Kulturart wächst. Landwirtinnen und Landwirte würden dabei eher von einer Reinkultur sprechen. Denn der Begriff Monokultur beschreibt den wiederholten Anbau der gleichen Pflanzenart auf derselben Fläche – und das über mehrere Jahre hintereinander. In einigen mehrjährigen Kulturen wie dem Obst- oder Weinbau kommt es unweigerlich dazu, dass sich Bäume und Rebstöcke nicht einfach versetzen lassen. Im Ackerbau steht der mehrjährige Anbau einer Kultur jedoch im Kontrast zu dem, was Landwirtinnen und Landwirte bei der Anbauplanung berücksichtigen: Es wird nämlich im Gegenteil darauf geachtet, dass sich die Art der Frucht möglichst oft abwechselt und der Zeitraum, bis eine bestimmte Kultur wieder angebaut wird, möglichst groß ist. Das bezeichnet man als Fruchtfolgeplanung.
Schädlinge und Krankheiten machen es sich bequem
Dass Monokulturen im verantwortungsvollen Ackerbau vermieden werden, hat gute Gründe. Denn eine Monokultur bringt einige Nachteile mit sich. Wenn eine Pflanze jedes Jahr auf der gleichen Fläche wächst, dann finden Schädlinge nach dem Überwintern auch jedes Jahr die gleichen Wirte, auf die sie spezialisiert sind. Das gilt ebenfalls für Pilze, Viren oder Schadbakterien. Die Fruchtfolge ist in diesem Sinne praktizierter Pflanzenschutz. Damit die Fruchtfolge aber funktioniert, dürfen die Pflanzen nicht zu nah miteinander verwandt sein. Zum Beispiel wird die Kohlhernie von einem Schleimpilz ausgelöst, der sich nicht nur an der Rapswurzel wohlfühlt, sondern auch an der Wurzel des nahverwandten Senfs, vom Weißkohl oder dem Radieschen. Alle vier gehören nämlich zur Gattung der Kohlgewächse (Brassica). Ein weiterer bedeutender Nachteil von Monokulturen ist der Nährstoffverbrauch. Pflanzt man beispielsweise nacheinander immer wieder die gleiche Kulturart an, die viele Nährstoffe benötigt, dann wird der Boden über die Zeit ausgelaugt – auf lange Sicht können die Erträge leiden und es wird ein großer Düngeaufwand notwendig. Außerdem haben es Schädlinge und Krankheiten bei ohnehin geschwächten Pflanzen leichter, sich zu verbreiten. Auch Unkräuter profitieren von ausgelaugten Böden und sorgen für zusätzlichen Arbeitsaufwand, der vermeidbar wäre.
Die Fruchtfolgeplanung sorgt für Abwechslung auf dem Acker
Um diese Nachteile zu vermeiden, kommt eine gut durchdachte und an den jeweiligen Standort angepasste Fruchtfolgeplanung ins Spiel. Eine typische Fruchtfolge zieht sich über vier bis sechs Jahre. Die Dauer der Fruchtfolge hängt dabei vor allem von der Mindestpause zwischen dem Wiederanbau der krankheits- und schädlingsanfälligsten Kultur ab. Beim Weizen muss zum Beispiel nur zwei bis drei Jahre gewartet werden, bis dieser erneut angebaut werden kann. Der Wiederanbau der Erbse kann hingegen schon mal bis zu zehn Jahre pausiert werden.
Die Fruchtfolge kann für positive Effekte auf die einander folgenden Pflanzen sorgen. Eine Leguminose wie der Klee oder die Erbse ist zum Beispiel in der Lage, Stickstoff im Boden einzulagern. Dieser dient dann der folgenden Kultur, wie etwa dem Weizen, als wichtiger Nährstoff. Auch wenn Fruchtfolgen mit mehr Planungsaufwand und einem größeren Einsatz unterschiedlicher Maschinen und Materialien verbunden sind, lohnen sie sich langfristig für die Landwirtschaft. Insbesondere hierzulande bewirtschaften Landwirtinnen und Landwirte ihre Flächen oft in langer Familientradition und achten daher sehr auf die Schonung ihrer Böden. Fruchtbare Flächen sind schließlich ein knappes Gut.