Wie sieht es im Rest der Welt aus – bei welchen Aspekten kann Deutschland, kann Europa, sich ein Vorbild an anderen Ländern bei der digitalen Transformation der Landwirtschaft nehmen?
Das föderale System in Deutschland ist ein starkes Hemmnis für die Digitalisierung. Hier könnten wir uns von verschiedenen Ländern, zum Beispiel Japan, die Schaffung eines zentralen Portals abschauen. Dieses stellt die wertvollen Daten, die in der öffentlichen Hand zu Boden, Wetter, etc. vorliegen, kostenfrei zur Verfügung. Andere Beispiele sind das Antragswesen und die Dokumentationspflichten. In Deutschland gibt es aktuell verschiedene Systeme, sodass der Landwirtinnen und Landwirte teilweise händisch und mit erheblichem Arbeitsaufwand dieselben Daten mehrfach eingeben müssen.
Auch bei der Förderung von neuen Technologien wie Agrarrobotik gibt es Unterschiede. In Frankreich etwa, gibt es dafür große Förderprogramme. Dort kommen Systeme früh in die Praxis und die Betriebe können bereits erste Erfahrungen sammeln, auch wenn die Systeme vielleicht noch nicht wirtschaftlich sind.
Werden angehende Landwirtinnen und Landwirte in der Ausbildung ausreichend auf die vielfältigen Anforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung vorbereitet?
In meiner Wahrnehmung nicht. Investitionen in Digitalisierung und hoch automatisierte Landtechnik erfordern, dass man diese Technologien versteht und so den Nutzen für den eigenen Betrieb abschätzen kann. Hier müssen entsprechende Themen in die Lehrpläne integriert werden, insbesondere bei Berufsschulen. Auch die Kombination von Reallaboren, in denen man neueste Technik anfassen und ausprobieren kann, mit Aus- und Weiterbildung, halte ich für zielführend.
Was muss passieren, um bei Landwirtinnen und Landwirten die Akzeptanz für digitale Systeme zu erhöhen und welche Rolle spielt die Politik dabei?
Politik muss zuallererst einmal stabile Rahmenbedingungen schaffen. Wenn Landwirtinnen und Landwirte sich nicht sicher sein können, ob es nächstes Jahr schon wieder neue Regelungen gibt, ist die Motivation sehr gering, Geld und Zeit in digitale Systeme zu investieren. Daneben muss – und das ist mir wichtig – der tatsächliche Einsatz dieser Systeme gefördert werden und nicht die Anschaffung. Dementsprechend sollten auch Weiterbildungsprogramme aufgebaut und gefördert werden. Wichtig ist auch, dass Landwirtinnen und Landwirte nicht das Gefühl bekommen, durch Digitalisierung zum gläsernen Betrieb zu werden. Hier muss es für den Betrieb eine einfache Möglichkeit geben zu überblicken und zu steuern, wer die eigenen Daten zu welchem Zweck erhält.
KI ist aktuell das heiße Thema. Die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz scheinen endlos – in welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial für die Landwirtschaft?
Künstliche Intelligenz kann vielfältig eingesetzt werden – insbesondere zur Interpretation von Sensordaten. Anwendungen können beispielsweise darin liegen, dass man aus Drohnenüberflügen exakte Informationen über Reifegrad, Ertrag, Anzahl, Position von Spontanvegetation, etc. erhält. Daneben ist die Einsparung von Pflanzenschutzmitteln durch gezieltes, pflanzengenaues Ausbringen ein realistisches Szenario mit bereits existierenden Produkten.
Spannend wird aus meiner Sicht, zu schauen, wie groß das Potenzial von Sprachmodellen wie ChatGPT für die Landwirtschaft ist. Es gibt erste Startups, die versuchen diese Modelle gezielt mit Agrarwissen zu erweitern – und zwar dahingehend, dass das Sprachmodell als Beratungsassistent in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden kann.
Welche weiteren Forschungsprojekte und Entwicklungen im Bereich digitaler Pflanzenbau finden Sie derzeit besonders spannend?
Es gibt aktuell einige Projekte wie beispielsweise AgriDataSpace oder die Industrieinitiative AgIn, die in Richtung Agrardatenräume und Interoperabilität arbeiten. Dies sind wichtige Grundlagenprojekte, um die Digitalisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Reiner Datenaustausch erzeugt aber erstmal noch keinen wirklichen Mehrwert für landwirtschaftliche Betriebe. Es sind vielmehr digitale Produkte, die auf Basis dieser Daten entwickelt werden können. Spannende Projekte in diesem Bereich sind die vom BMWK [Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz] geförderten Projekte Agri-Gaia und NaLamKI. Agri-Gaia entwickelt ein Ökosystem, mit dem KI-Verfahren leichter und damit kostengünstiger entwickelt werden können. Das Schwesterprojekt NaLamKI erzeugt ein Portal, in dem landwirtschaftlichen Betrieben KI-Verfahren zur Verfügung gestellt werden.
Auch agrifoodTEF ist ein sehr spannendes EU-Projekt. Hier sollen Test- und Validierungsumgebungen in Europa geschaffen werden, innerhalb derer Firmen leichter Produkte entwickeln können, die auf KI und Robotik basieren. Ziel ist, dass aus der Spitzenforschung in Europa mehr Produkte mit einem entsprechenden Nutzen in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie resultieren.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Stiene

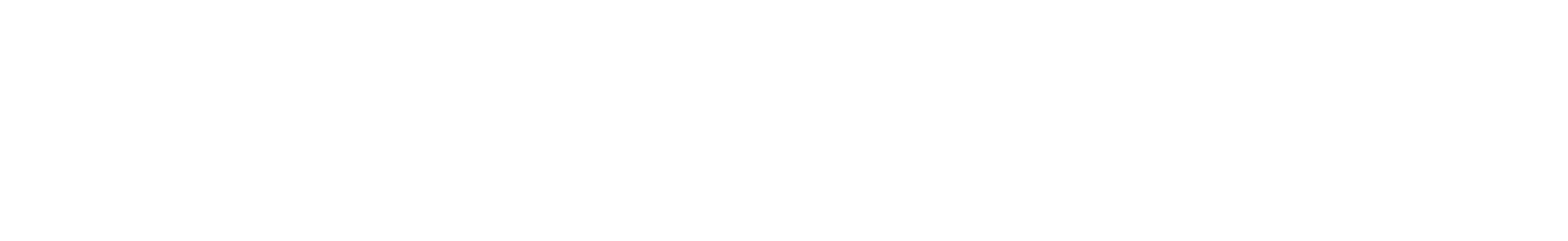




![MagicTrap_9[46]](https://www.die-pflanzenschuetzer.de/wp-content/uploads/MagicTrap_946-scaled.jpg)

